Das Japan-Beben 2011 und dessen angeblicher Auslöser
Das sogenannte Tōhoku-Erdbeben in Japan vom 11. März 2011 erreichte eine Stärke von neun auf der Magnituden-Skala und war damit das stärkste jemals gemessene Erdbeben in Japan. Die Erschütterungen brachten zahllose Gebäude zum Einsturz und über die dann noch ein Tsunami hinwegrollte.
Bisher war unklar, wieso das Beben eine derartige Stärke erreichen konnte. Nun sollen Bohrungen im Bereich des Epizentrums des Bebens vor der Küste Japans gezeigt haben, dass eine ungewöhnlich dünne und schlüpfrige Schicht den enormen Rutsch der beiden hier aufeinandertreffenden bzw- liegenden Kontinentalplatten begünstigt haben soll. Denn in der sogenannten Subduktionszone soll sich die Pazifische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zehn Zentimetern pro Jahr unter die Philippinische schieben und derart den Japangraben bilden.
Die Plattentektoniktheorie setzt unabdinglich voraus, dass es sich dabei nicht um ein gleichmäßiges Gleiten handelt, sondern sich Spannungen aufbauen, die sich in Form von Erdbeben lösen. Die Platten ruckeln sich gleichsam vorwärts. Wie groß die jeweilig „freigesetzte“ Bewegung ist, soll dabei von der aufgebauten Spannung und von der Art des Materials abhängen, auf dem die Gleitbewegung statfinden soll. Im vorliegenden Fall von 2011 betrug der Weg der Gleitbewegung angeblich 30 bis 50 Meter. Dadurch soll die verheerende Welle, die nach dem Erdeben über die Küste Japans hereinbrach, ausgelöst worden sein.
Ein internationales Forscherteam trieb im Rahmen des „Japan Trench Fast Drilling Projekts“ von einem Bohrschiff aus drei Löcher in die Tiefe des Japangrabens, um das Material der Bruchzone untersuchen zu können. Dabei ergab sich, dass die Grenzschicht der beiden Kontinentalplatten im Bereich des Epizentrums mit etwa 5 m extrem dünn ist: es handelt sich um die angeblich dünnste Plattengrenze auf der Erde, sagen die Forscher um Christie Rowe von der McGill University in Montreal. So sei die entsprechende Schicht im Fall der San-Andreas-Verwerfung in Kalifornien (USA) mehrere Kilometer dick. Die Wissenschaftler glauben, dass es bei der Verschiebung der tektonischen Platten nur zu einer vergleichsweisen sehr geringen Reibung gekommen ist: Einmal in Bewegung, soll die Rutschung deshalb heftig gewesen sein. Dies ergaben angeblich Analysen, die Rückschlüsse auf die Wärmeerzeugung zuließen, die bei der Reibung während der Verschiebung entstanden ist.
Die Analyse des Materials der dünnen Trennschicht soll aus einem extrem feinen Sediment bestehen und zwar aus sehr „schlüpfrigem“ Ton. Reibt man ihn zwischen den Fingern, fühlt er sich an wie ein Schmiermittel. Deshalb soll es bei der Rutschung sehr wenig Reibungswiderstand gegeben haben, so dass sich die gesamte Spannung auf einen Schlag entladen konnte. Als Vergleich wird ein Effekt in Bezug auf das Gleiten von Langlaufskiern auf Schnee: „Im Ruhezustand kleben die Ski ein wenig am Schnee und es braucht eine gewisse Kraft, um sie in Bewegung zu setzen. Dann entsteht allerdings Wärme und bei der anschließenden Gleitbewegung entsteht weniger Widerstand“, erklärten die Fachleute.
Quelle: Science, Ausgabe vom 5.12.2013
Kommentar
Grundlage der Plattentektonik-Hypothese bildet die 1906 von H.F. Reid entwickelte elastische Entspannungstheorie. Diese geht davon aus, dass sich in Gebieten, wo die Erdkruste infolge tektonischer Bewegungen langsam, aber stetig deformiert wird, sich elastische Spannungen so lange aufbauen, bis an der schwächsten Stelle die Bruchspannung erreicht wird. Der Herdbereich entspannt sich momentan. Ein Teil der Energie (maximal 50 %) wird bei der Rückfederung in elastische Wellenenergie umgesetzt. Die Theorie wird auch heute noch als im Wesentlichen zutreffend angesehen. Wird die Beanspruchung des Materials zurückgenommen, ohne dass es zum Bruch gekommen ist, so bleibt die Probe größtenteils verformt; da nur ein relativ geringer Anteil der elastisch gespeicherten Energie zur elastischen Rückfederung führt. Derart sollen z. B. Tsunamis in den Ozeanen erzeugt werden und Fachleute schnippen dazu in Fernsehsendungen bildlich erklärend mit den Fingern.
Tatsächlich ist der Vorgang bodenmechanisch komplizierter, da das Gestein plastisch wird und nicht plötzlich in Form eines Sprödbruches bricht, sobald ein kritischer Spannungszustand überschritten wird. Wird die Beanspruchung des Materials zurückgenommen, ohne dass es zum Bruch gekommen ist, so bleibt die Probe größtenteils verformt; nur ein relativ geringer Anteil elastisch gespeicherter Energie führt zur elastischen Rückfederung, die allerdings nicht „explosionsartig“ und damit zu gering als auslösender Impuls für einen Tsunami erfolgt. Eine »elastische Speicherung« von Spannungen ist derart auch nicht möglich, da das Gestein durch die behinderte Reibung aufreißen und damit das Speicherungspotenzial verlieren würde. Außerdem ist die Spannung des Gesteins bei behinderter Reibung etwa mehr als 14-mal so groß wie die Bruchspannung (siehe Berechnung: Der Energie-Irrtum, 2009, S. 74).
Im vorliegenden Fall des Japan-Bebens wurde, um diese Argumente zu umgehen, von einer Gleitreibung bzw. einer schlüpfrigen Tonschicht gesprochen. Da Reibung unabhängig von der Größe der Kontaktfläche auftritt, dürfte keine Durchdringung in dieser nur 5 m dicken Schicht vorhanden sein, da sonst die volle Reibungskraft wirkt und keine Gleitreibung einsetzen kann. Aber auch wenn dieser angeblich schlüpfrige Ton als eine ideale Gleitschicht vorhanden wäre, müsste die Haftreibung im Ruhezustand überwunden werden. Danach würden dann tatsächlich geringere Reibungswiderstände einsetzen. Setzen wir hierfür einen Gleit-Reibbeiwert an, der etwa 10% des Haftreibungsbeiwertes entspricht, ist die auftretende Spannung immer noch wesentlich größer als die Bruchspannung.
Fazit: Das (fiktive) »elastische Speichern« plattentektonischer Verschiebungsprozesse vor dem Bruch übt keinen Einfluss auf die Entstehung von Tsunamis aus. Eine gegebenenfalls auch ruckartige zentimeterweise Bewegung von tektonischen Platten würde impulsmäßig auch nicht ausreichen, um einen Tsunami zu erzeugen bzw. alle Moleküle einer mehrere Kilometer hohen Wassersäule zum Schwingen zu bringen, wie experimentell in kleinerem Maßstab in einem Gartenteich von Jedermann nachgestellt werden kann.
Die so genannten Subduktionszonen, in denen sich die schwere, aber dünne Ozeanplatte unter die leichtere Kontinentalplatte (mit entsprechender Reibung) schieben soll, ist denn auch nur ein Mythos der Geophysik, denn die an den ozeanischen Rücken (Spreizungszonen) laufend neu entstehende Ozeankruste muss ja irgendwo vernichtet werden, falls man von einem in etwa konstanten Erdumfang ausgeht, nachdem die Geophysik früher sogar von einer schrumpfenden Erde ausging. Berücksichtigt man jedoch eine Erdexpansion, also eine wachsende Erde, und damit keine Subduktionszonen, dann wird die Erde um die Fläche der an den mittelozeanischen Rücken neu gebildeten Ozeankruste kontinuierlich größer und der Widerspruch in Bezug auf Subduktion löst sich auf, da sich unterschiebende Platten gedanklich nicht mehr benötigt werden.
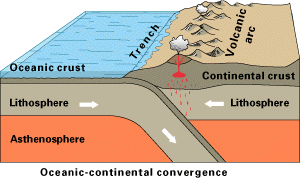
Zum Japanbeben und dessen wirklicher Auslöser lesen Sie bitte: Die Erde im Umbruch, 2011, S. 282–291.
Im Widerspruch zur Geophysik: Tiere können, wie unzählige Male nachgewiesen, von der Geophysik nicht akzeptierte Vorläufererscheinung von derartigen tektonischen Beben fast prophetisch vorahnen, wofür die Geophysik keine Erklärung hat, da der elastische Rückprall ja plötzlich erfolgen soll.
Auszug aus Der Energie-Irrtum: „Chinesische Forscher von der Nanyang Normal Universität in Henan entdeckten mehrere Wochen im Vorfeld von zwei schweren Erdbeben im Süden des Irans ungewöhnliche Wolkenlücken, obwohl sich die umliegenden Wolken bewegten. Gleichzeitig beobachteten die Wissenschaftler in beiden Fällen eine Erhöhung der Bodentemperatur entlang der Bruchlinien. Russische Wissenschaftler hatten schon in den 1980er-Jahren Temperaturveränderungen und ungewöhnliche Wolkenformationen im Vorfeld von Erdbeben beobachtet. Obwohl sich hier Phänomene entlang von Bruchlinien zeigten, hat dies nichts mit Plattentektonik zu tun, und es gibt auch keinen Ansatz für ein konventionelles Erklärungsmuster. Deshalb gibt Erdbebenforscher Mike Blanpied vom Geologischen Dienst der USA zu bedenken: »Es gibt kein physikalisches Modell, mit dem man erklären könnte, warum etwas zwei Monate vor einem Erdbeben plötzlich auftritt und gleich wieder verschwindet, ohne noch einmal wiederzukehren.« Dagegen hegen die chinesischen Forscher die von mir geteilte Meinung, dass die Wolken von Gasen aufgelöst wurden, die aus der Bruchlinie austraten. Damit ließe sich auch die Temperaturerhöhung in diesem Gebiet erklären, schildern sie weiter (Guo/Wang, 2008).“

